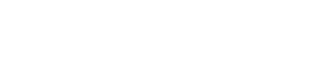„Wer einmal nach Iona gekommen ist, wird dreimal wiederkommen.“ Das behauptet zumindest ein altes gälisches Sprichwort, das man im Torbogen zum Kreuzgang der Iona-Abbey lesen kann.
Prädikantenarbeit
Die einzigen Gemeinden mit Zukunft seien die mit diakonischem Profil, sagte jüngst ein Kollege zu mir. In Gedanken bin ich daraufhin die Gottesdienstbesuche der vergangenen Monate durchgegangen und weil es zu meiner Arbeit gehört, viele unterschiedliche Gottesdienste an vielen verschiedenen Orten zu besuchen, gibt es da eine Stichprobenwahrheit …
Prädikantin Anja Bergemann aus Carlow (Mecklenburg) hat beim Predigtwettbewerb der Monatszeitschrift PASTORALBLÄTTER den 2. Preis gewonnen. Insgesamt 53 Prädikantinnen und Prädikanten aus allen Landeskirchen der EKD beteiligten sich an dem Wettbewerb für Ehrenamtliche im Verkündigungsdienst.
Anja Bergemann ist seit 10 Jahren Prädikantin in der Nordkirche und war bis 2020 Sprecherin der Prädikant*innen der Nordkirche und Mitglied im Prädikantenausschuss. Außerdem ist sie Teil des Ausbildungs-Teams für die Ausbildung der Lektorinnen und Lektoren in den Kirchenkreisen Mecklenburg und Lübeck-Lauenburg.
Ihre preisgekrönte Predigt zum 6. Sonntag nach Trinitatis erzählt Geschichten von Krisenerfahrungen zwischen Job und Corona-Depression im Jahr 2021, aber auch von den Sorgen und Ängsten der Jünger und Jüngerinnen Jesu in biblischer Zeit.
Alltagsnah und konkret möchte die Prädikantin predigen, die in ihrem Hauptberuf technische Zeichnerin ist. Diesen Anspruch teilen vermutlich die meisten Profis im Verkündigungsdienst. Wie unterscheiden sich also die Predigten von Prädikant*innen und Pastor*innen? Lässt sich dieser Unterschied beschreiben? Macht es Sinn, dass es einen Predigtpreis für Prädikant*innen gibt? Oder liegt dahinter doch die Annahme, dass die Predigten von Prädikant*innen mit denen der studierten Profis nicht konkurrieren können? Über diese Fragen lässt sich diskutieren. Sie können uns gern dazu schreiben (z.B. an claudia.suessenbach@gemeindedienst.nordkirche.de).
Fest steht jedoch: Prädikant*innen haben in der kirchlichen Verkündigung mittlerweile eine festen und anerkannten Platz. Das macht dieser Wettbewerb deutlich. Und wir im Team der Prädikantenausbildung der Nordkirche sind stolz auf „unsere“ Prädikantin Anja Bergemann und gratulieren ihr von Herzen!
Claudia Süssenbach
Eine Gemeindepädagogin erzählt: „Da war ein Kind, das wusste in einem Moment meinen Namen nicht mehr. Da hat es mich genannt: die Gottessprecherin.“ Die von Gott spricht. Die im Namen Gottes spricht. Die spricht, und dann ist Gott da.
Die Gemeindepädagogin erzählt den Kindern von St. Martin und vom Nikolaus. Sie singt und kennt Gebete. Sie hört gut zu und fragt die Kinder, wie es für sie ist, wenn Gott da ist. So einfach kann das sein, auch für Erwachsene. Das genügt: dass Gott da ist im Reden und Hören, in der Musik und in den Liedern. Und in dem Gesicht eines Menschen, der selber von Gott angerührt ist.
Unsere Gottesdienste brauchen viel weniger Worte. Dafür solche, die Gott mitbringen. Es müssen nicht immer Pastoren sein, die das tun. Es braucht Gottessprecherinnen und Gottessängerinnen, Gottesschweigerinnen und Gotteszeigerinnen.
Zunehmend bekommen Gemeindepädagoginnen und Diakone den Auftrag, Gottesdienst zu feiern und zu predigen. Dazu gibt es im kommenden Jahr auch eine Fortbildung, bezahlt vom Kirchenamt.